Diese Signale verraten Handlungsbedarf im Team
In 80 Fragen um die Team-Welt: Organisationsentwickler Pascal Romann hat einen «Team-Kompass» entwickelt. Damit möchte er Teams zur besseren Zusammenarbeit befähigen – und zu Höchstleistungen bringen. Sein Tool stellt er gratis zur Verfügung.

Es ist wichtig, sich im Team abzustimmen, um den Erfolg garantieren zu können. (Bild: ChatGPT / Canva)a
Hochleistungsteams, die ebenso effektiv wie effizient zusammenarbeiten, wo sich alle respektieren, aber auch herausfordern, sind die Idealvorstellung vieler Führungskräfte, was die Menge an Forschung wie auch Bestseller zum Thema erklärt. Patrick Lencionis Buch «Die 5 Dysfunktionen eines Teams» als eine der letzten grossen Publikationen in 2002 brachte das Thema wieder mehr ins Scheinwerferlicht und verdeutlicht die Wichtigkeit von Teamentwicklung. Die Basis dazu legte Tuckman aber bereits in 1965: Er erklärte damals, dass Teams, durch die Phasen eines Forming, Storming und Norming gehen müssen, bevor die Hochleistungsphase (Performing) starten kann. Schlüsselfrage ist somit, wie diese Phasen zu durchlaufen sind resp. wie und wo Teamentwicklung anzusetzen hat, damit am Schluss hochwirksame Teams resultieren. Pascal Romann, Organisationsentwickler, Coach und ETH-Dozent in Teilzeit behauptet, dass mit seinem Team-Kompass mühelos eine Antwort auf diese Frage gefunden werden kann.
HR Today: Nach 80 Fragen zu wissen, wie man zu einem Hochleistungsteam kommt, ist ein vollmundiges Versprechen. Was soll an Ihrem Team-Kompass anders sein?
Pascal Romann: Anstelle sich auf einen Themenbereich zu fokussieren wie etwa die Zusammenarbeit in Lencionis Bestseller, integriert der Team-Kompass eine Vielzahl an Modellen und Konzepten, beispielsweise psychologische Sicherheit, organisationale Energie oder auch Selbstorganisation. Dadurch entsteht ein gesamtheitlicherer Blick auf ein Team mit seinen Stärken und Handlungsfeldern, was den Fragebogen und den daraus resultierenden Bericht zum Team besonders macht.

Eine Vielzahl von Konzepten und Modellen – aber was für Faktoren entscheiden am Ende, ob ein hochfunktionales Team entsteht?
Genau diese Frage stellte mir eine Teilnehmerin vor einem Jahr während eines Leadership-Seminars an der ETH und ich hatte damals keine Antwort darauf. Zwischenzeitlich glaube ich, dass vier Dimensionen dabei eine Rolle spielen. Zunächst: Die Sachdimension für einen Fokus auf Resultate und Zielerreichung. Ein Unternehmen und damit auch seine Teams existieren, weil ein Sachzweck erreicht werden will, etwa ein marktfähiges Produkt oder ein kundentaugliches Dienstleistungsangebot. Sich auf dieses Sachziel auszurichten und die Zielerreichung gemeinsam sicherzustellen, ist entsprechend wichtig.
Und doch «menschelt» es in Teams ja ständig – nur um die Sache geht es selten.
Exakt, darum braucht es auch die Beziehungsdimension für einen Fokus auf die Qualität der Zusammenarbeit. Der soeben erwähnte Teamoutput kann entweder leicht oder mit Anstrengung erzielt werden, was von der Qualität der Zusammenarbeit und damit der Beziehungsdimension abhängt. Identifiziert man sich mit den Aufgaben, wissen alle, wer für was zuständig ist, und unterstützt man sich gegenseitig, gestaltet sich das Miteinander sehr viel einfacher, als wenn Grabenkämpfe und Konkurrenzdenken dominieren.
Grabenkämpfe entstehen doch dort, wo Altes verteidigt werden will. Es braucht Offenheit für Neues.
Nichts ist so konstant wie die fortwährende Veränderung. Ein Marktumfeld, das sich weiterentwickelt. Technologien, die sich erneuern. Oder eine Organisations- und Teamstruktur, die angepasst wird. Deshalb sind kontinuierliches Lernen und Erneuern ebenso wichtig wie die Fähigkeit, als Team mit Widerständen und Niederlagen umgehen zu können. Darum ist die Lerndimension für einen Fokus auf Innovationskraft und Resilienz eine weiterer wichtiger Teamfaktor.
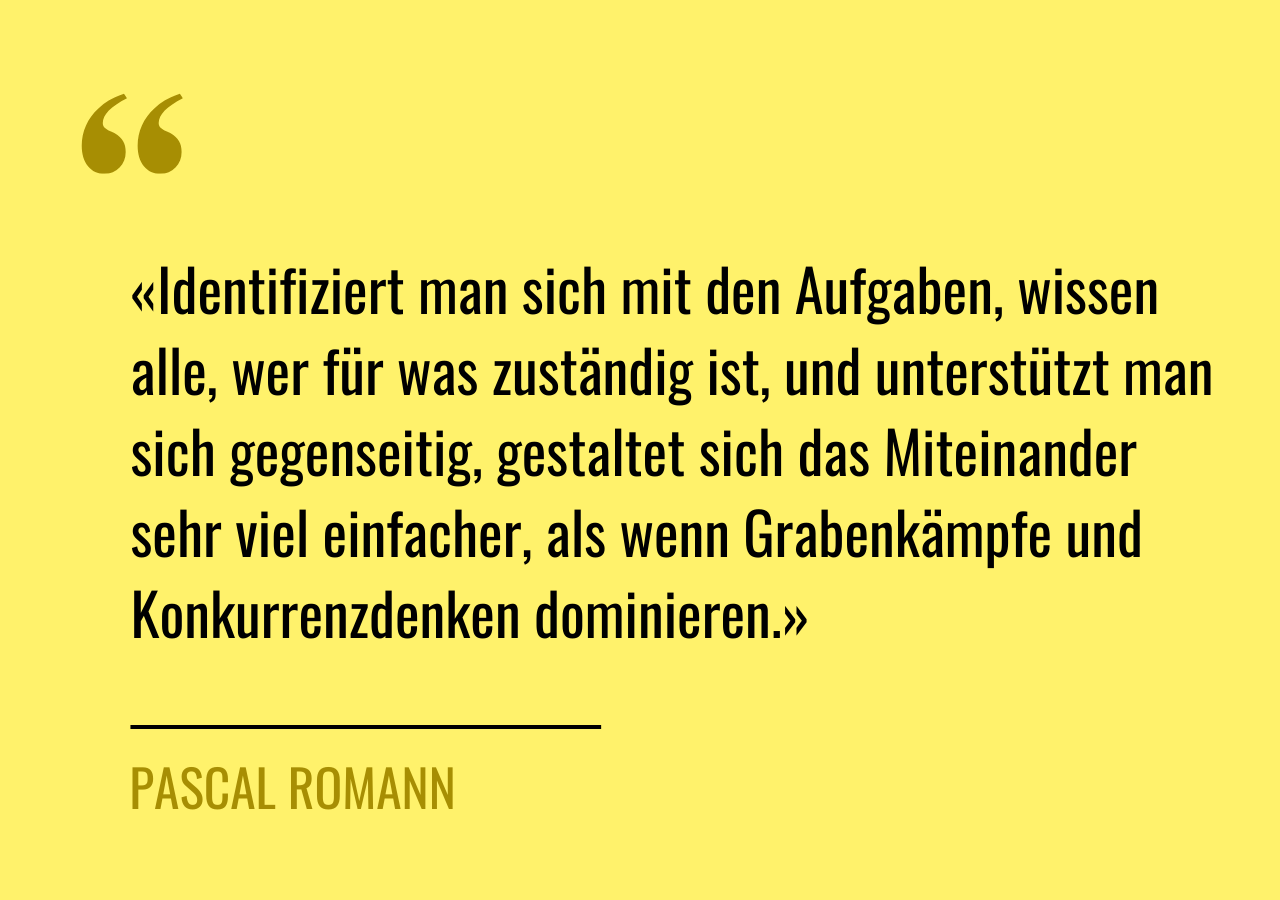
Und welche vierte Dimension bleibt übrig?
Ja, die Führungsdimension für einen Fokus auf die Angemessenheit der Führung. Trotz Trends wie «Unbossing» und «Servant Leadership», braucht es Führung weiterhin, da dadurch die Koordination, der Zusammenhalt und die Weiterentwicklung im Team sichergestellt wird. Vielleicht sind die Führungsaufgaben aber nicht alle auf eine Person konzentriert, sondern als «Shared Leadership» im Team verteilt. Entsprechend wichtig ist es, die Angemessenheit der Führung in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team zu überprüfen.
Das klingt einleuchtend, aber auch etwas kompliziert – und ist am Ende Theorie. Haben Sie konkrete Beispiele, um das Zusammenspiel dieser vier Dimensionen zu verdeutlichen?
Ich erinnere mich an folgende Situationen, die ich im Rahmen von Teamentwicklungen begleitete. Ein sehr vertrautes Miteinander im Team, viele kennen sich sogar privat und um die Freundschaften nicht zu gefährden, schaut man innerlich frustriert über mangelhafte Leistung und fehlende Veränderungsbereitschaft hinweg. Ein Hochleistungsteam mit viel Innovationskraft, das sich aufgrund schwellender Konflikte nicht mehr abstimmt, sodass Doppelspurigkeiten und Konkurrenzdenken entstehen. Oder eine Führungskraft, die nach mehreren Leitungswechsel vom Team nicht akzeptiert wird, da sich dieses zwischenzeitlich selbst organisiert hat. Indem zeitgleich die Sach-, die Beziehungs-, die Lern- und die Führungsdimension betrachtet werden, entsteht ein gesamtheitliches Teambild und können solche Wechselwirkungen nicht nur erkannt, sondern vor allem diskutiert und aufgelöst werden.
Ist der Team-Kompass somit vor allem etwas für Organisationsentwickelnde mit entsprechendem Vorwissen zu Teams – oder auf wen zielt dieser Fragebogen ab?
Der Team-Kompass und seine Fragen können von Führungskräften oder dem Team selbst ebenso gut verwendet werden wie durch HR-Business-Partner und Organisationsentwicklende. Der resultierende Bericht ist selbsterklärend und zeigt auf, wo Stärken zu bewahren und wo Handlungsfelder anzugehen sind, damit das Team sein volles Potenzial realisieren kann.


