«Fire and forget»?
Konflikte am Arbeitsplatz werden oft verdrängt statt gelöst. Ein Plädoyer für die Mediation.

Keine Zeit ist eine Ausrede. (Bild: ChatGPT / Canva)
Was hat Mediation mit Kommunikation und Kollaboration zu tun? Alles und nichts. Wenn Vorgesetzte offene Kommunikation und Kollaboration fördern und die fünf Schritte zu mehr psychologischer Sicherheit am Arbeitsplatz beherzigen (siehe Beitrag von Bryan Stallings auf www.hrtoday.ch1), werden Konflikte frühzeitig angesprochen und bereinigt. Aufgrund von Hierarchien, Change-Prozessen, wirtschaftlichem Druck oder einer «Wir machen keine Fehler»-Kultur können Mitarbeitende verstummen, Ängste aufkommen, Konflikte schwelen und schliesslich offen ausbrechen.
Was ist das Resultat? Die Kollaboration im Team leidet, es besteht die Gefahr der psychischen Erkrankung von Mitarbeitenden, langjährige Teamstützen kündigen oder die Vorgesetzte entlässt das schwächste Teammitglied, ohne zu merken, dass der Unruheherd ein anderer ist. 57 Prozent aller psychisch bedingten Arbeitsausfälle werden durch eskalierende Konflikte am Arbeitsplatz ausgelöst.2 Muss das sein? Oder könnten wir versuchen, rechtzeitig einzuschreiten und Konflikte zu lösen, bevor sie eskalieren? Können Konflikte am Arbeitsplatz überhaupt gelöst werden?
Mediation erfolgt nach klar strukturiertem Verfahren
Die Mediation ist eine Form der aussergerichtlichen Konfliktlösung, bei der neutrale Dritte (Mediatorinnen und Mediatoren) die Beteiligten darin unterstützen, in Konflikten selbstverantwortlich einvernehmliche Regelungen zu finden. Genaueres Wissen zur Mediation ist noch nicht weit verbreitet: «Über die Bedingungen und Möglichkeiten der Mediation sind im Wissen der KMU-Unternehmer nur vage und ungenaue Vorstellungen abgelagert. Es wird in Schweizer Unternehmen noch oft davon ausgegangen, dass jeder eine Mediation durchführen kann, der mit einer ordentlichen Portion gesundem Menschenverstand gesegnet ist».
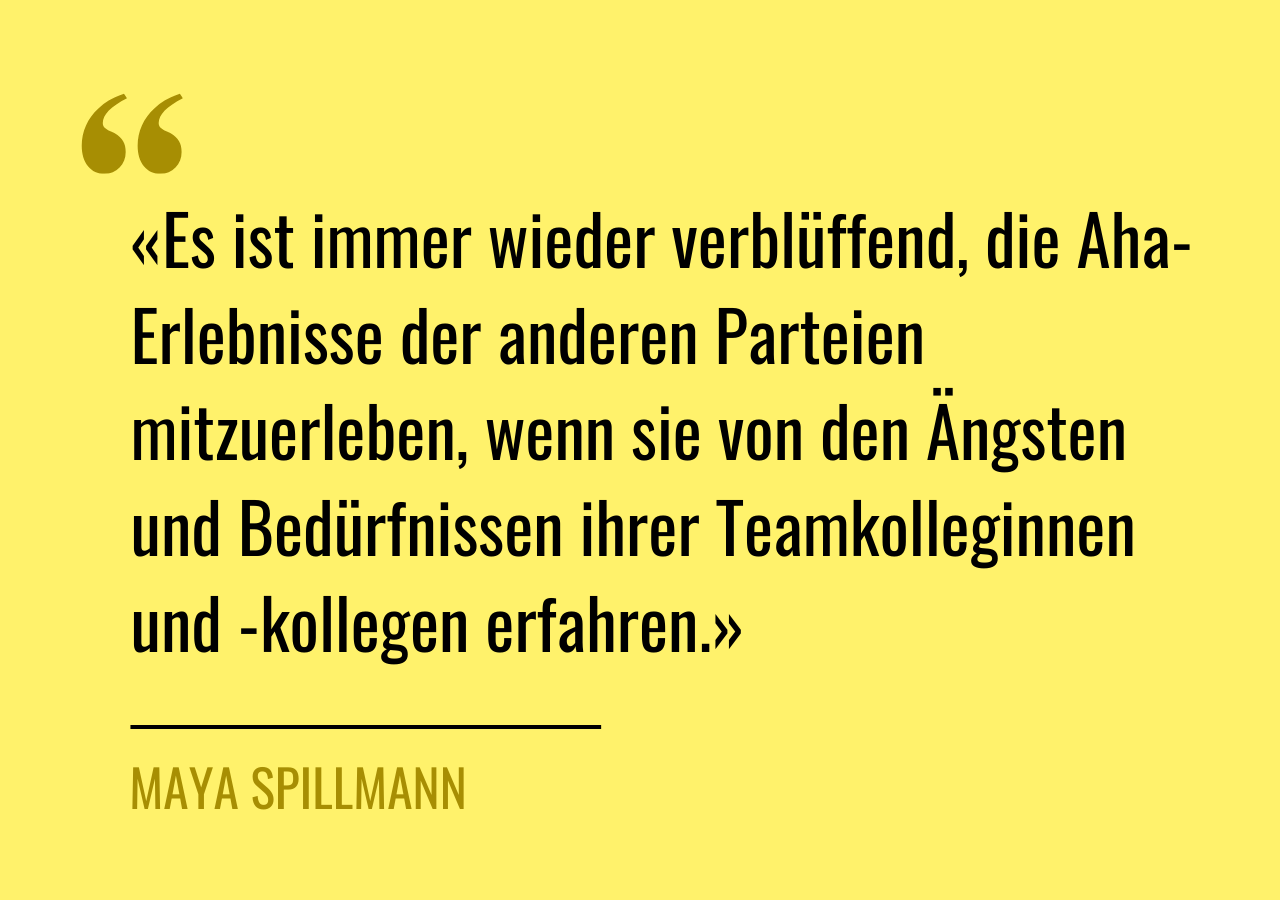
Entgegen dieser Annahme ist das Verfahren der Mediation sehr strukturiert. Man unterteilt typischerweise fünf Phasen. Jede Phase baut auf der vorhergehenden Phase auf. Dabei wird, nachdem Auftrag und Ziel der Mediation gemeinsam mit allen beteiligten Konfliktparteien geklärt sind, ein erster Fokus auf die Sammlung und Gewichtung der Konfliktthemen gerichtet. Dies dient zur Orientierung und Absteckung des Umfangs der Mediation und soll die Konfliktparteien aus einer Ohnmacht herausführen und in eine Position der Eigenmächtigkeit und Selbstverantwortung bringen. In einem nächsten Schritt kommen die heissen Themen auf den Tisch. Die Bedürfnisse und Interessen der Parteien werden eruiert. Schliesslich erarbeiten und verhandeln die Parteien gemeinsam, unter Anleitung der Mediatorinnen und Mediatoren, realistische Lösungen, die schliesslich in einer verbindlichen Vereinbarung dokumentiert werden.
Kommunikation und Kollaboration ist im Mediationsverfahren das A und O. In den ersten drei Phasen werden die Parteien darin unterstützt, sich zunächst einmal ihrer eigenen Interessen in Bezug auf die strittigen Themen bewusst zu werden und diese dann auch im geschützten Umfeld zu kommunizieren. Es ist dann immer wieder verblüffend, die Aha-Erlebnisse der anderen Parteien mitzuerleben, wenn sie von den Ängsten und Bedürfnissen ihrer Teamkolleginnen und -kollegen erfahren. Der folgende kollaborative Prozess zur Problemlösung ist häufig sehr lustvoll – meistens ziehen die Teammitglieder in dieser Phase am gleichen Strick und in die gleiche Richtung.
Zeitdruck ist nur eine Ausrede
«Wir haben keine Zeit für eine Mediation» ist oft zu hören. Gegenfrage: Haben Sie Zeit für die Kündigungsgespräche, die Suche nach neuen Mitarbeitenden und deren Einarbeitung?
Im Gegensatz zu einem gerichtlichen Prozess ist die Mediation ressourcenschonend, sowohl personell als auch finanziell. Natürlich braucht auch eine sorgfältig durchgeführte Mediation ihre Zeit. Nur schon die Analyse, wer an der Mediation teilnehmen soll, muss genau durchgeführt werden. Ist es ein Teil des Teams oder das ganze Team? Ist der Vorgesetzte Teil des Problems oder gar der Auslöser? Kann der Vorgesetzte gleichzeitig die Mediatorinnen oder Mediatoren beauftragen und als Partei an der Mediation teilnehmen?
Je nach den vorgefundenen Umständen werden die Mediatorinnen und Mediatoren zur Vorbereitung Einzelgespräche führen müssen, um zu verstehen, worum es im Konflikt «eigentlich» geht, wer beteiligt ist und ob die Beteiligten überhaupt bereit sind, sich auf ein gemeinsames Gespräch einzulassen. Je nach Anzahl Beteiligter können mehrere Sitzungen mit unterschiedlichen Teilnehmenden notwendig werden.
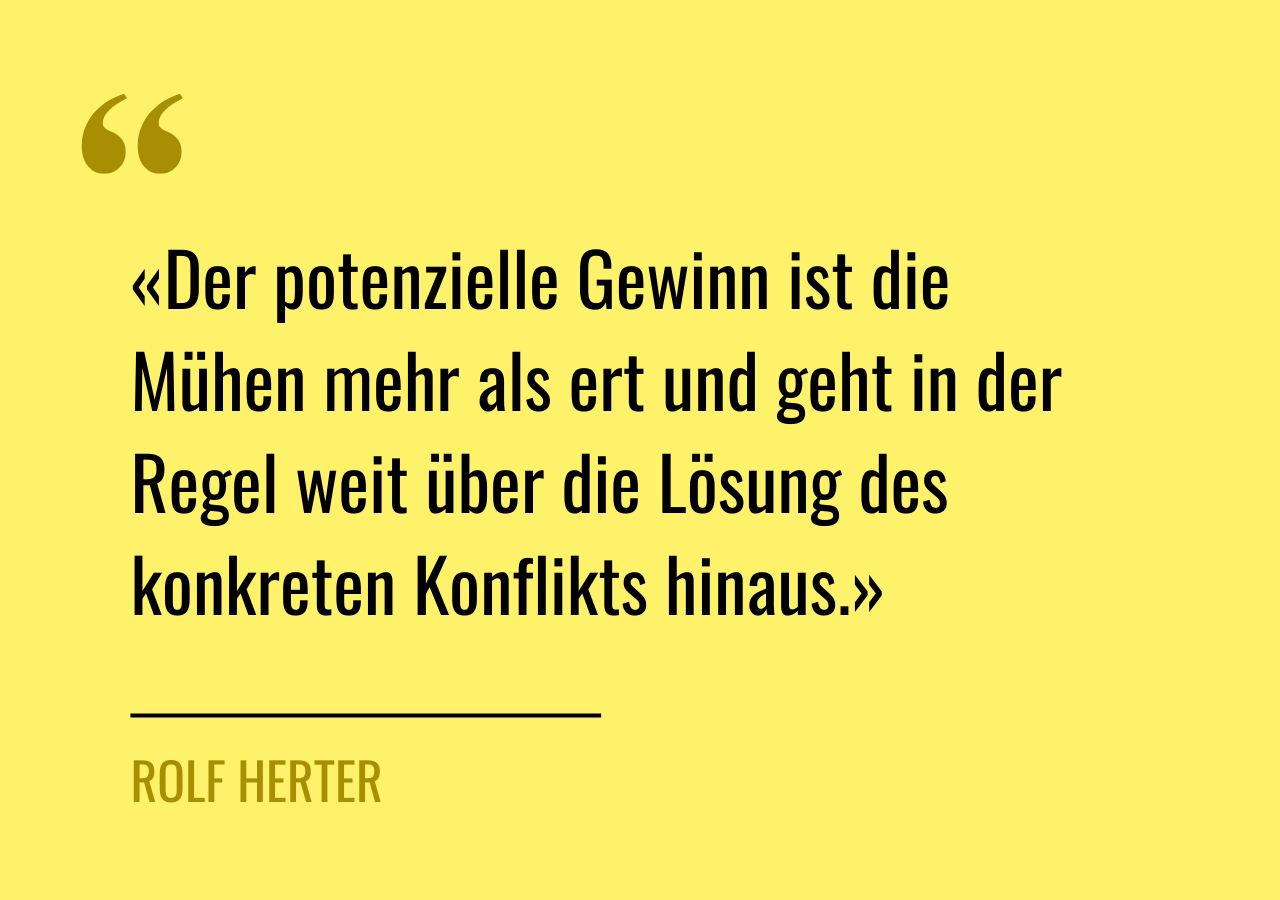
Erwarten Sie also nicht eine magische Sitzung, nach der alle Probleme weggeblasen sind. Der Mediationsprozess braucht seine Zeit und muss mit dem weiterlaufenden operativen Betrieb koordiniert werden.
Der potenzielle Gewinn ist die Mühen mehr als wert und geht in der Regel weit über die Lösung des konkreten Konflikts hinaus. Die Konfliktlösung ist nachhaltig, weil sie von den Teammitgliedern selbst erarbeitet wurde. Die Mitarbeitenden lernen die Perspektiven ihrer Teamkolleginnen und -kollegen kennen, sie lernen auch, ihre eigenen Prozessabläufe kritisch zu hinterfragen, und damit einher geht in der Regel ein kooperativerer Kommunikationsstil. Wertvolle Arbeitsbeziehungen können erhalten oder wiederhergestellt werden und die in der Mediation erfahrene Wertschätzung wirkt motivierend.
Konfliktursachen können mannigfaltig sein
«Eine gut funktionierende Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen ist eine hochkomplexe und vielschichtige Angelegenheit. Art, Aufbau und Ausrichtung von Organisationen können sehr unterschiedlich sein. Sie haben ihrerseits wesentlich Einfluss auf die Zusammenarbeit der Menschen.»
Konflikte können durch Change-Prozesse ausgelöst werden. Auch strukturelle Probleme können verursachend sein, häufig fehlt es auch schlicht an gegenseitiger Wertschätzung. Oft sind die am Konflikt beteiligten Personen durch Hierarchien und Machtgefälle voneinander getrennt. Die Mediatorinnen und Mediatoren erarbeiten daher gemeinsame Fairness- und Gerechtigkeitskriterien. Sie sind sich bewusst, dass es branchenspezifische blinde Flecken gibt und dass diese in der Entstehung des Konflikts eine wesentliche Rolle spielen können. Wichtig ist auch hier: Die einzelnen Parteien sind und bleiben die Expertinnen und Experten für das Fachthema.
Konflikte sind häufig vielschichtig. Die Konfliktursachen können daher nicht immer genau eruiert werden. Das Resultat eines Konflikts ist aber immer eine dauerhaft gestörte Kommunikation, sei dies zwischen Mitgliedern des Teams oder zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter.
Mediation beruht auf Freiwilligkeit
Die grosse Stärke der Mediation, die Eigenverantwortlichkeit und Gleichwertigkeit der Parteien, ist gleichzeitig die grösste Hürde. Mediation beruht auf Freiwilligkeit. Zunächst muss erkannt werden, dass die Kommunikation gestört ist und ein Konflikt besteht. Es braucht die Einsicht des Managements, dass der Konflikt so eskaliert ist, dass die interne Besprechung allein nicht mehr ausreicht und ein neutraler Dritter beigezogen werden sollte. Das sind schon recht hohe Hürden. Wenn diese Hürden gemeistert sind und ein Mediationsteam mandatiert ist, ist die Konfliktlösung immer noch nicht garantiert, aber in über 75 Prozent aller Mediationsverfahren werden gute und nachhaltige Lösungen gefunden. Die Mediatorinnen und Mediatoren unterstützen die Parteien mit der Absicht, eine transparente Kommunikation mit Offenlegung der gegenseitigen Interessen zu erreichen – gelingt das, liegt der Erfolg nahe.
