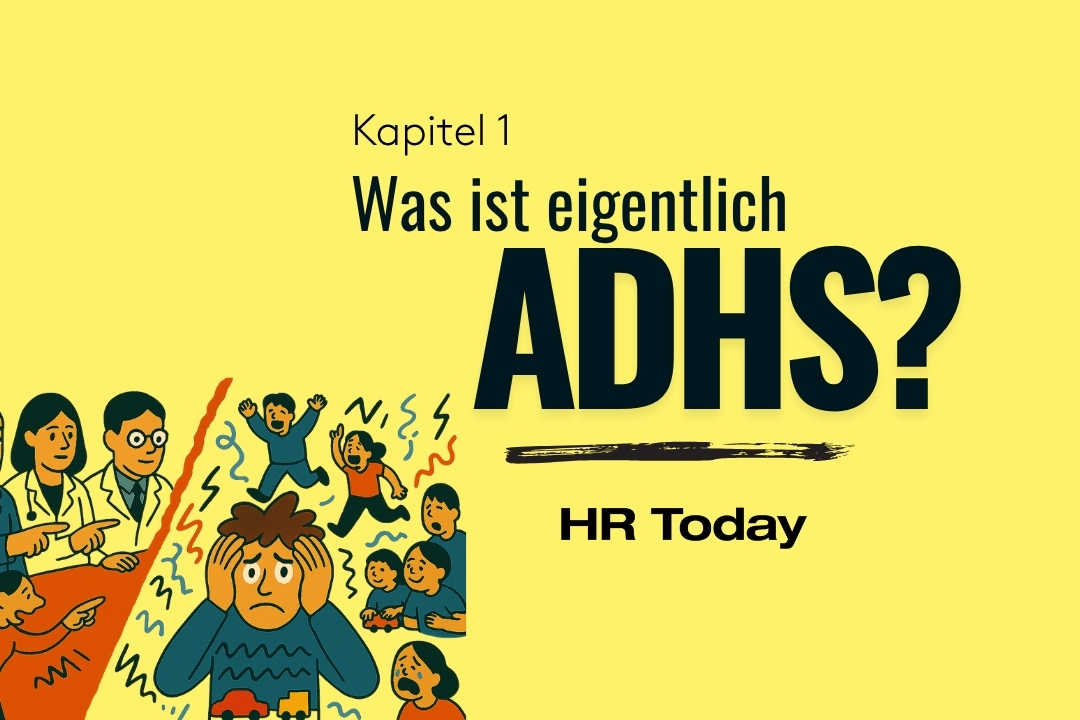ADHS: Privatsache Psyche?
Das Gehirn ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere spielt sich draussen ab – in Klassenzimmern, RAVs, Büros, Wartezimmern. Wer ADHS verstehen will, muss auch die Welt sehen, in der es entsteht. Warum psychisches Leiden politisch ist.
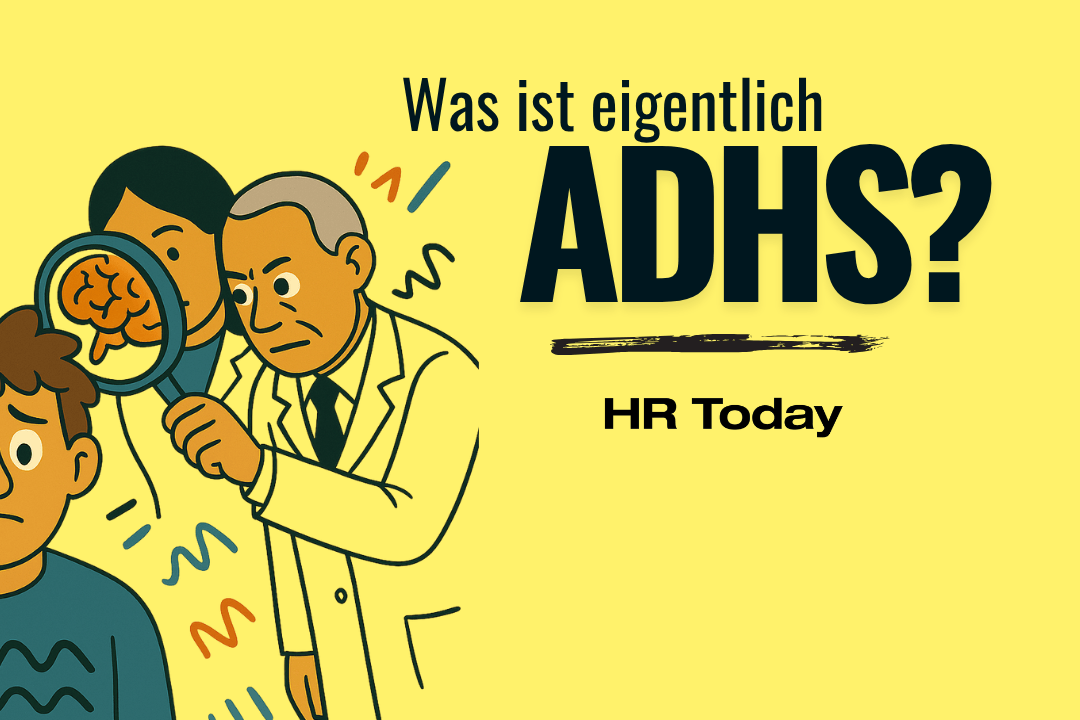
Im letzten Kapitel haben wir uns die Hirnforschung angesehen und festgestellt: Beim Betrachten des Thema ADHS stellen sich nicht nur Fragen dazu, inwiefern sich die in Diagnose-Manualen verbürgten Symptome auf Hirnstrukturen zurückführen lassen. Sondern auch Fragen zu grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Problemen. Nur mit Hirnforschung kommt man der «Tatsache ADHS» nicht bei, es braucht interdisziplinäre Ansätze. Diese Forderung wiederum geht mit der Frage einher: Wessen Forschung wird weshalb gefördert? ADHS als Fokusthema der Hirnforschung führt uns direkt ins nächste Thema: Ist das Hirn etwa politisch?
Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan
Sie befinden sich hier: Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert
Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Kapitel 6 – Ritalin: Wer therapiert hier eigentlich wen?
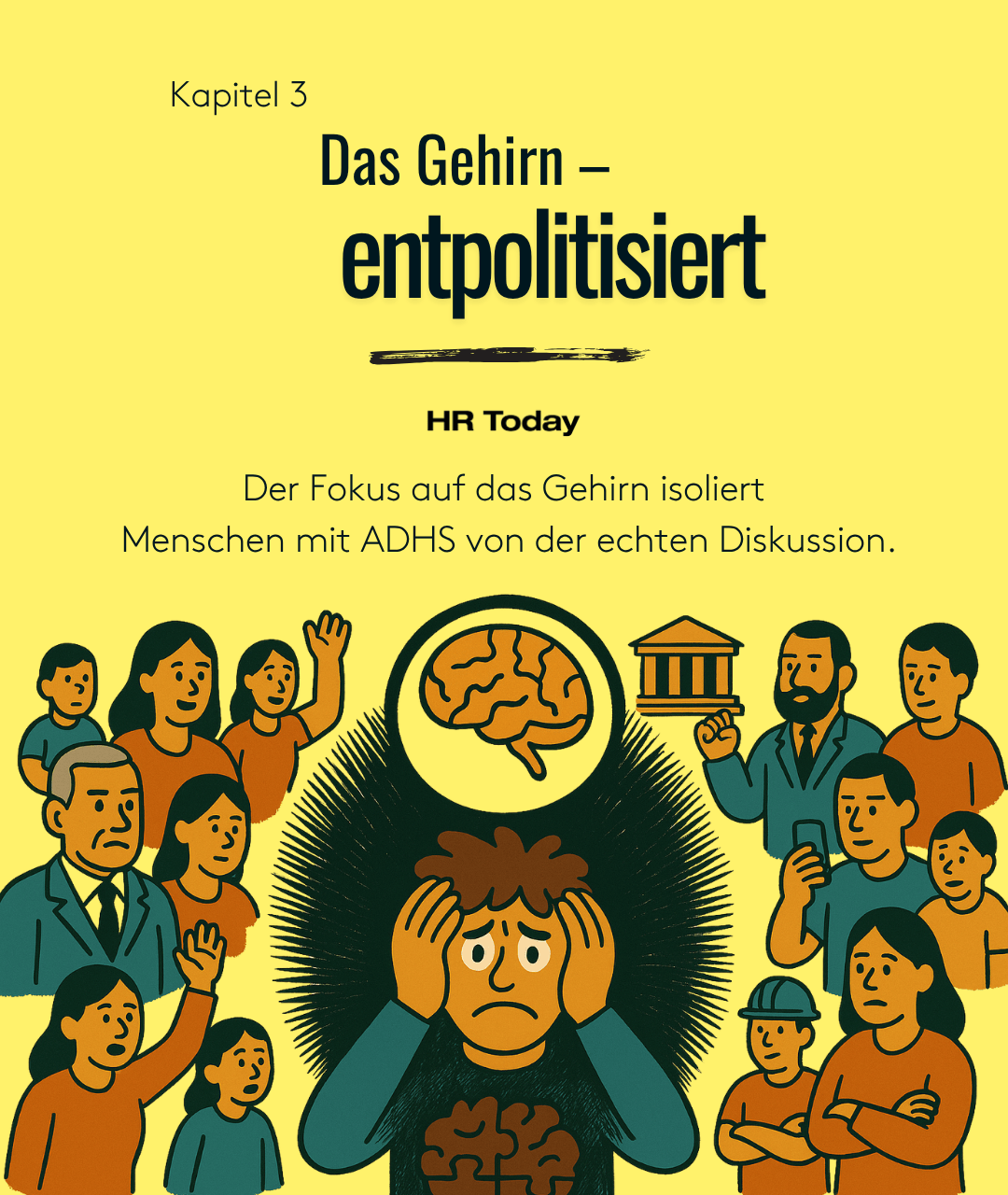
Zu oft werden die Stimmen Betroffener ignoriert – aus ideologischen und politischen Gründen. (Bild: ChatGPT / rs / Canva)
Dass sich das Verständnis von ADHS mit der Zeit vom «moralischen Defekt» zu einer medizinischen Beschreibung verschoben hat, ist – wie bereits erwähnt – grundsätzlich als positive Entwicklung zu bewerten. Doch die Intensität, mit der sich die Forschung sowie mediale Berichterstattung der vergangenen Jahre so stark auf neurologische Erklärungsmodelle fokussiert, bringt hingegen weitere Probleme mit sich.
Dieser Fokus beeinflusst nicht nur den gesellschaftlichen Umgang mit ADHS, sondern prägt auch breiter, wie wir über psychische Krankheiten sprechen. Und immerhin wurde ADHS lange Zeit als psychische Störung eingeordnet. Erst mit der schrittweisen Umstellung der diagnostischen Leitlinien, wie sie etwa in den letzten Jahren international eingeführt wurden, begann man ADHS primär durch eine neurologische Linse zu betrachten.
Wie sich der neurologische und medizinische Schwerpunkt in Forschung und Medien wiederum auf den Umgang mit psychischen Krankheiten auswirkt, untersuchte beispielsweise Kulturwissenschaftler Mark Fisher. Der Brite befasste sich bis zu seinem Suizid 2017 intensiv wissenschaftlich und essayistisch mit Depressionen. Er zeigte in seiner Arbeit, dass auf diese Art psychische Leiden entpolitisiert – und damit auch ihre sozialen Ursachen unsichtbar gemacht würden.
Depressionen haben diagnostisch gesehen ein nicht unähnliches Hindernis wie ADHS. Auch Fisher war klar, dass im Gehirn von depressiven Menschen etwas anders funktioniert als bei nicht depressiven Menschen. Allerdings lässt sich die lange vorherrschende Theorie, wonach Depressionen auf ein gestörtes Gleichgewicht des Botenstoffs Serotonin im Gehirn zurückzuführen seien, nicht überzeugend belegen, wie diverse Metaanalysen von Studien zeigen.
Für Fisher sagt der Fakt, dass psychische Krankheiten neurologisch verankert sind, jedoch nichts darüber aus, weshalb sie entstehen. Indem man sie auf Hirnchemie reduziert, verlagere man die Verantwortung vollständig auf das Individuum – und entziehe sie damit der Gesellschaft.
«Du bist wegen deiner Hirnchemie krank», fasste Fisher pointiert zusammen. Doch wenn Leid strukturelle Ursachen hat, reiche es nicht, Kranke einfach individuell zu therapieren. Vielmehr müsse das Thema wieder allgemeinen Eingang in die Politik finden. Jenseits von Debatten über Krankenkassenprämien und Therapiekosten. Auf dem Spiel stehe stattdessen die Frage, welche sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen Menschen überhaupt krank machen würden. Eine Gesellschaft, die psychisches Leid ernst nehmen wolle, müsse sich nicht nur um bessere Gesundheitsversorgung kümmern, sondern um grundsätzliche Veränderungen.
Die heisse «Verantwortungskartoffel» wird hin- und hergeworfen
Seine These: Die Vorstellung des «individuellen Funktionierens» hat eine politische Geschichte – und dahinter steckt eine Ideologie, die, wie Fisher es ausdrückte, Verantwortung und Stress «privatisiert». Für Fisher war ein gesellschaftliches Umdenken in Bezug auf psychische Gesundheit ein dringendes und nicht etwa ein zeitloses Anliegen. So analysierte er das Thema im Kontext der neoliberalen Austeritätspolitik von Margaret Thatcher, die sich mit einem berühmten Ausspruch gegen ein kollektives, gesellschaftliches Verständnis des Lebens stellte:
«Sie laden ihre Probleme bei der Gesellschaft ab. Dabei gibt es so etwas wie die Gesellschaft gar nicht. Es gibt einzelne Männer und Frauen, und es gibt Familien. Und keine Regierung kann irgendetwas tun, ausser durch Menschen – und Menschen müssen zuerst für sich selbst sorgen. Es ist unsere Pflicht, für uns selbst zu sorgen, und dann – auch – für unsere Nachbarn», sagte Thatcher 1987 in einem Interview.
Sie behauptet damit also nicht nur, dass es so etwas wie eine Gesellschaft tatsächlich gar nicht gebe, sondern auch, dass die Probleme, denen Menschen im Alltag begegnen, zuvorderst ihre eigenen Probleme seien. Jedoch missachtete Thatcher, dass diese Probleme im Zusammenleben entstehen können und die Politik das Zusammenleben reguliert – und regulieren soll.
Wenn Menschen mit ADHS also grundsätzlich stärker auf sensorische Reize reagieren und diese Menschen genauso Teil der Welt – auch der Arbeitswelt – sind, stellt sich die Frage: Laden diese Menschen wirklich ihre Probleme auf andere Menschen ab – oder setzen manche Menschen ihre Ideen ohne Rücksicht auf andere durch? Und entstehen dadurch nicht genau Probleme im Zusammenleben, die eigentlich nicht sein müssten? Auch Thatchers Sicht lässt sich hier nicht nur als Einbahnstrasse formulieren. Richtiger wäre es wohl zu sagen: Es kann nicht reine Privatsache sein, wie und warum das gesellschaftliche Leben manchen Menschen mehr zusetzt als anderen – insbesondere, wenn zugleich beklagt wird, psychische Leiden würden unser Gesundheitssystem belasten.
Hier stellt sich die provokative Frage: Wie weit entfernt ist man eigentlich noch von eliminatorischen Ansichten, wenn man jede Verantwortung auf direkt Betroffene und ihre Familien abwälzt, keine gesellschaftlichen Voraussetzungen schafft, unter denen alle zurechtkommen können, und den Betroffenen letztlich sogar grundlegende Unterstützung im Gesundheitswesen verweigert? Auch hier wieder sei auf einen Punkt aus dem ersten Kapitel verwiesen: In den USA existieren jetzt bereits politische Bestrebungen, die an die Zeiten der Eugenik erinnern.
Auch der Begriff «Neurodiversität» hat seine Probleme – und ist nur ein Zwischenschritt
Insofern macht man neurodivergente Menschen bei blosser Reduktion auf ihr Hirn angreifbar, statt die Erklärmodelle mit den sozialen Dimensionen zu verweben und alle Aspekte zusammenzudenken.
Aus einem ähnlichen Grund steht auch der Begriff der «Neurodiversität» und «Neurodivergenz» zunehmend in der Kritik. Nicht, weil er grundlegend falsch wäre, sondern, weil er zu kurz greift. Menschen mit ADHS, Autismus oder psychischen Krankheiten unterscheiden sich eben nicht nur durch ihre Gehirne von anderen Menschen. Sie unterscheiden sich zu neurotypischen Menschen in Sachen Sozialisation, in ihrem Zugang zu Bildung, ihrer ökonomischen Realität und die Art und Weise, wie sie gesellschaftlich gelesen werden – nämlich oft als grundlegend anders.
So konnte beispielsweise eine Studie von 2017 belegen, dass neurotypische Menschen weniger willens sind, mit autistischen Menschen zu interagieren. Nicht nur das: Die Studie fand auch heraus, dass es neurotypischen Menschen ausgesprochen leicht fällt, autistische Menschen zu erkennen, dies nur auf Basis von «ersten Eindrücken» – und diese schliesslich zu negativen Bewertungen dieser Menschen führen.
Spannend hierbei auch: Während es lange hiess, neurodivergente Menschen hätten mehr soziale Mühe im Umgang mit Menschen, legt diese Studie nahe, dass das nicht einfach eine Einbahnstrasse ist. Zwar haben neurodivergente Menschen Mühe, neurotypische Menschen zu lesen, umgekehrt gilt aber dasselbe. Heisst: Das Problem geht in beide Richtungen. Auch hier wird sofort klar: Nur mit dem Hirn hat das nicht zu tun und eine Reduktion neurodivergenter Menschen auf ihr Hirn ist kaum fruchtbar.
Hin zu neuer Sprache
Trotzdem hält auch Psycholinguistin und ADHS-Forscherin Elena Haegi (siehe letztes Kapitel) den Begriff «Neurodivergenz» nicht für grundlegend verkehrt, sondern sieht ihn als nötigen Zwischenschritt zu dem, was in Zukunft kommen kann. Sie weiss aber auch: Hier gibt es noch eine Lücke in unserer Sprache, eine Lücke, die sich nicht ausschliesslich auf den Begriff der Neurodivergenz bezieht:
«Nicht nur fehlt der wissenschaftlich fundierte Wortschatz, sondern auch der soziale: Wie beschreibt man Symptome? Wie beschreibt man Leidensdruck? Liegt der Fokus auf einem Problem oder einer möglichen Lösung? Liegt der Fokus auf dem Einfluss des ADHS auf die Betroffenen oder auf deren Umfeld? Welche Konnotation beinhalten Wörter oder Begriffe wie «Aufmerksamkeitsdefizit» oder «Neurodivergenz»?
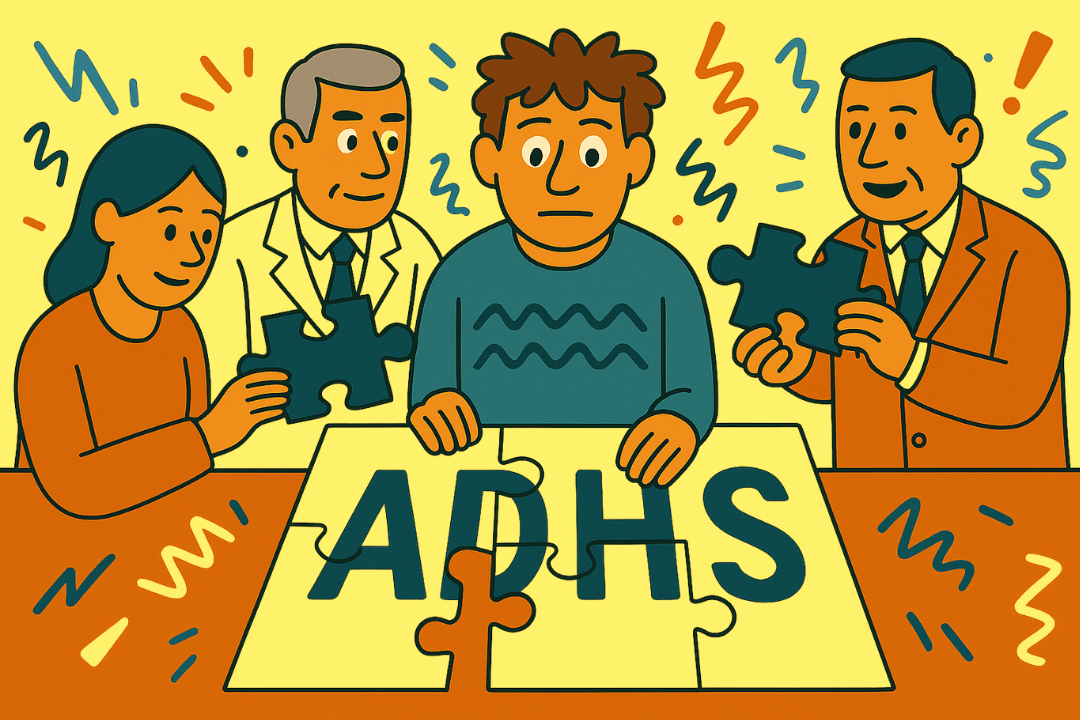
Das Rätsel ADHS kann nur gemeinsam befriedigend gelöst werden. (Bild: ChatGPT)
Zusammengefasst: Was ADHS ist, lässt sich bis heute aufgrund all dieser Verquickungen nicht eindeutig beantworten. Doch gleichzeitig ist das, was wir über ADHS wissen – und was nicht – auch kein blosser Zufall. Die Forschung folgt bestimmten Interessen und bevorzugt gewisse Erklärungsmodelle, während andere Fragen weitgehend ausgeklammert werden. Dabei sind Menschen mit ADHS selbst kaum Teil des Erkenntnisprozesses, egal ob als Betroffene oder Forschende. Ihre Bedürfnisse, ihre Ideen und Lebensrealitäten bleiben deshalb unsichtbar – selbst in der Forschung, die sich mit ihnen beschäftigt .
So entsteht ein verzerrtes und lückenhaftes Bild von ADHS, das primär durch institutionelle und wirtschaftliche Logiken geprägt ist. Das erschwert nicht nur das alltägliche Reden über ADHS, sondern auch dessen Diagnose. ADHS ist kein Objekt, das es zu fixieren gilt, sondern ein Verhältnis, das sich in Bewegung befindet.
Oder: Es ist ein Puzzle aus vielen verschiedenen Teilen. Nur einzelne Teilchen anzusehen, bringt uns kaum weiter. Wir müssen versuchen, das Thema in seiner Gesamtheit zu betrachten.
Weiter zu Kapitel 4: Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Die ADHS-Sommerserie erscheint in wöchentlich ein bis zwei Kapiteln. Wir informieren Sie jeweils über unseren Spezial-Newsletter, sobald neue Teile erscheinen.
Wir haben schon einige Rückmeldungen auf unsere ADHS-Serie erhalten. Darunter: Dank, Fragen, eigene Erlebnisse. Ich möchte diese Nachrichten gerne in eines der späteren Kapitel einfliessen lassen. Haben Sie Fragen, Input – oder möchten Ihre eigenen Erfahrungen zu ADHS mit mir teilen? Schreiben Sie an robin.schwarz@hrtoday.ch