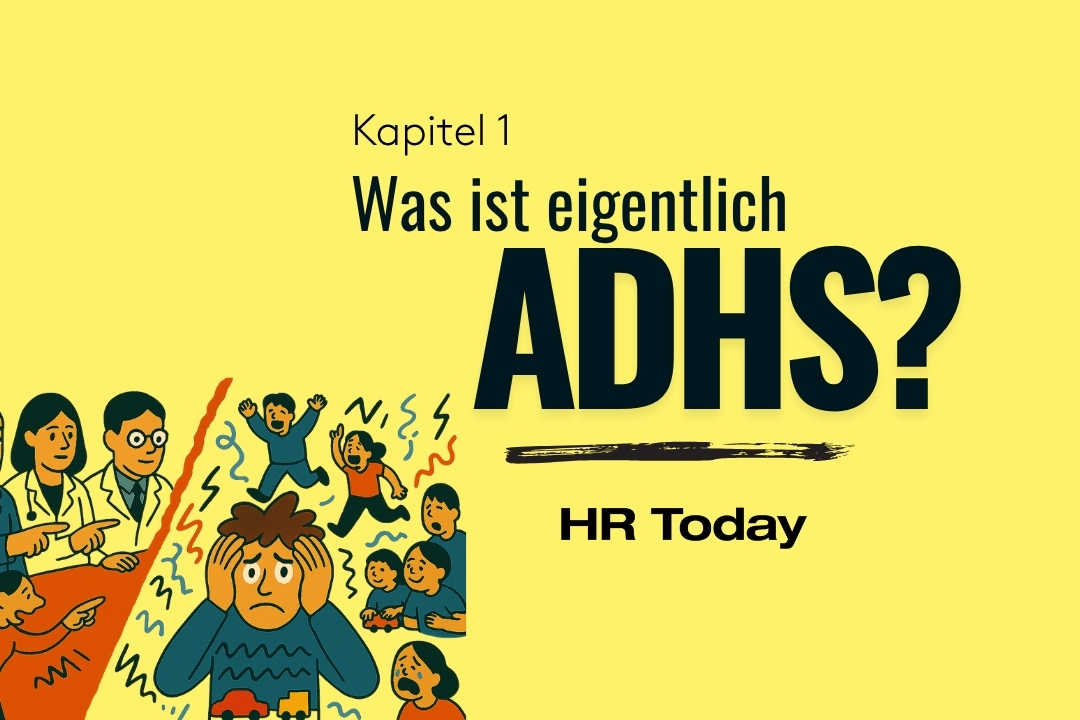Von Hirnscans und Grenzfragen: ADHS zwischen Biologie und Gesellschaft
Liegt die Antwort auf die Frage nach ADHS in unserem Schädel? Das Gehirn steht bei Erkläransätzen von ADHS oft im Fokus – doch lässt sich der Alltag neurodivergenter Menschen auf Synapsen und Dopamin reduzieren? Weshalb Hirnforschung wichtig, aber nicht ausreichend ist.

Im letzten Kapitel haben wir entdeckt: Die ADHS-Diagnose hat sich mit der Zeit stark gewandelt. Sie hat sich von einem «moralischen Defekt» zu einem «Defekt» des Hirns gewandelt mit starkem Fokus auf dem Verhalten von Betroffenen. Das senkt zwar in gewisser Weise den Druck, der auf Betroffenen lastet, ADHS bleibt aber immer noch eine Sache, die es individuell zu bewältigen gibt. Wir haben aber auch gesehen, dass die wissenschaftliche Untersuchung nicht der einzige Einflussfaktor auf ADHS als Phänomen ist – der Begriff Neurodiversität würde heute nicht existieren, ohne dass auch eine aktivistische Dimension in den Diskurs eingeflossen wäre.
Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Sie befinden sich hier: Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: ADHS zwischen Biologie und Gesellschaft
Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Hirn – entpolitisiert
Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Kapitel 6 – Ritalin: Wer therapiert hier eigentlich wen?
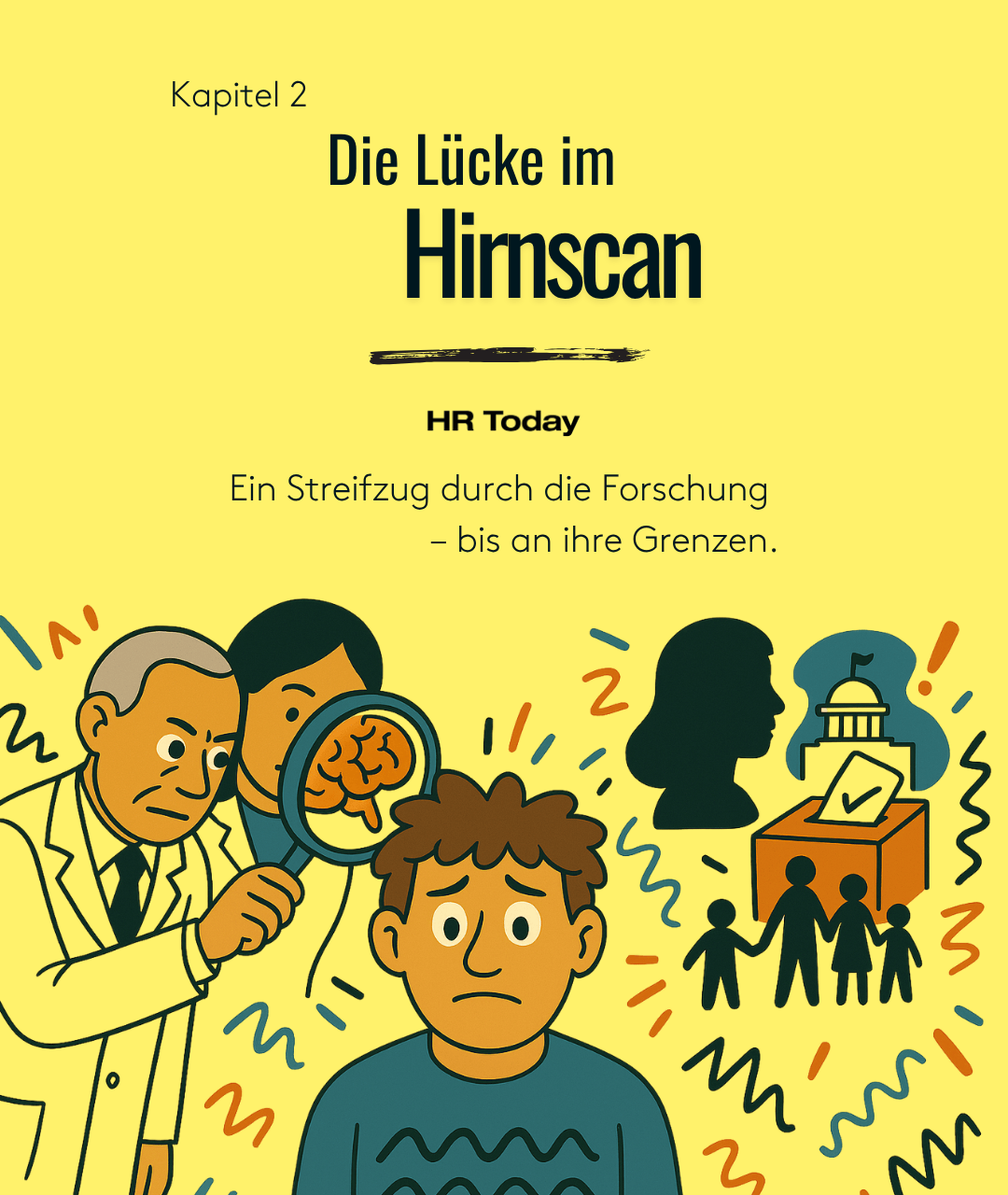
Bei ADHS steht man nicht nur vor einem diagnostischen oder wissenschaftlichen, sondern vor einem erkenntistheoretischen Problem (Bild: ChatGPT / rs / Canva)
Bereits die Komplexität des Begriffswandels zeigt, dass die Frage «Was ist eigentlich ADHS?» gar nicht so einfach zu beantworten ist. Auch der Fokus auf die Hirnfunktion hat die Probleme, die im Zusammenhang mit ADHS entstehen, nicht aufgelöst, sondern sie verschoben und andere Ansätze zur Behandlung ins Zentrum der Diskussion gestellt – ein Fortschritt, aber wohl kaum der letzte.
Aber auch die Neurologie, der im aktuellen Diskurs bereits seit längerer Zeit grosse Beachtung geschenkt wird, hat keine einfachen Antworten. Mittlerweile gehört ADHS gemäss den Diagnose-Manualen primär zu den neuronalen Entwicklungsstörungen. Als solche betrifft sie die Entwicklung des Gehirns, zum Beispiel der Nervenbahnen des Gehirns.
Eine relativ neue Studie gibt zum Beispiel Hinweise, dass bei manchen neurodivergenten Menschen Synapsen nicht auf dieselbe Weise eliminiert werden, wie bei neurotypischen Menschen. So werden im Hirn synaptische Verbindungen eliminiert, die eher selten gebraucht werden – ein Vorgang, der ganz normal ist, aber eben nicht bei allen gleich funktioniert.
Eine mögliche Deutung davon: Das Hirn von Menschen mit Neurodivergenzen filtert Reize weniger stark und erlaubt so grössere Räume für Assoziationen und somit kreatives Denken, ist dafür weniger klassisch «effizient». Oder, etwas salopper und spekulativer formuliert: Womöglich legen Gedanken bei Menschen mit Neurodivergenzen grössere «Distanzen» zurück – mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.
Ein anderes klassisches Erklärmodell zu ADHS fokussiert sich weniger auf Gehirnstrukturen an sich, sondern auf Neurochemie, etwa die Rolle des Botenstoffs Dopamin im Hirn. Dabei haben Menschen mit ADHS zwar theoretisch gesehen gleich viel Dopamin im Hirn wie neurotypische Menschen, das Dopamin wird aber schneller «abtransportiert», was bedeutet, dass das Dopamin dort weniger verfügbar ist, wo es gebraucht wird. Sprich: Wie das Gehirn von Menschen mit ADHS mit Dopamin umgeht, ist in gewisser Weise «ineffizient».
Das Ergebnis: Mehr Langeweile, weniger Motivation und exekutive Dysfunktion. Heisst: Es wird für Menschen mit ADHS ungemein schwieriger, den «inneren Schweinehund» zu überwinden, als das bei neurotypischen Menschen der Fall ist.
Wie bringt man das Hirn und die Diagnose zusammen?
Doch all diese Ansätze – von Genetik über Hirnstrukturen bis zur Neurochemie – haben eine gemeinsame Lücke: Sie lassen sich nur schwer mit den Symptomen in den Diagnose-Manualen in Einklang bringen.
Das weiss auch Psycholinguistin Elena Maja Haegi. Sie ist Expertin zum Thema ADHS mit Forschungsfokus auf den Zweitspracherwerb sowie Lehr- und Lernstrategien – und selbst ADHSlerin und Autistin. In Ihrer Masterarbeit an der Universität Basel hat sie sich unter anderem intensiv mit dem aktuellen Forschungsstand zum Thema ADHS auseinandergesetzt.
«Viele der Symptome in den offiziellen Diagnosekatalogen sind nicht einfach auf die Hirnanatomie zurückzuführen, auch wenn verschiedene Hirnscan-Studien versucht haben, Zusammenhänge zu finden», sagt Haegi.
«Man hat zwar herausgefunden, dass verschiedene Hirnareale bei ADHS-Diagnostizierten scheinbare Veränderungen im Vergleich zu Menschen ohne Diagnose aufweisen. Trotzdem ist noch nicht klar, weshalb es diese Veränderungen gibt, welche Einflüsse diese haben – und inwiefern sie überhaupt relevant sind für ADHS.»
«Viele der Symptome in den offiziellen Diagnosekatalogen sind nicht einfach auf die Hirnanatomie zurückzuführen, auch wenn verschiedene Hirnscan-Studien versucht haben, Zusammenhänge zu finden.»
– Elena Maja Haegi, Psycholinguistin
Wir stehen hier also nicht nur vor einem wissenschaftlichen, sondern vor einem erkenntnistheoretischen Problem: Wollen wir vom Gehirn auf ADHS schliessen – oder vom Phänomen ADHS auf das Gehirn? Gibt es das vermutete «ADHS-Gehirn», müssten die Symptome in den Diagnose-Manualen darauf zurückzuführen sein. Wenn das nicht möglich ist, was messen die Manuale dann?
Nimmt man hingegen die Diagnose-Manuale – als pragmatisches Instrument, das sich im klinischen Alltag bewährt hat – als primäres Erklärmodell, dann wird es problematisch, ADHS als rein neurologisches Phänomen zu behandeln.
Denn die diagnostischen Kriterien sind nicht einfach neurowissenschaftlich entstanden, sondern sozial und historisch gewachsen, durch Normsetzung, Beobachtung und Beurteilungen. Die Idee, man könnte diese Symptome schliesslich «rückwirkend» im Hirn vorfinden, setzt voraus, dass sich soziale Kategorien lückenlos ins Biologische einfügen lassen. Das ist bisher alles andere als klar.
«Die Idee, man könnte diese Symptome schliesslich «rückwirkend» im Hirn vorfinden, setzt voraus, dass sich soziale Kategorien lückenlos ins Biologische einfügen lassen.»
Können wir wirklich den sozial und kulturell gewachsenen menschlichen Umgang mit Abweichung naturwissenschaftlich erklären – und Geschichte und Kultur somit «naturalisieren»? Statt diese beiden Konzepte – die im Umgang mit der menschlichen Psyche immer wieder für grosse Debatten sorgen – als Gegenspieler zu betrachten, könnte es hilfreicher sein, sie miteinander zu vereinen und versuchen, sie kompatibel zu machen.
Und trotzdem: Neurologische Forschung ist alles andere als nutzlos
Es wird immer klarer, dass sich die «Tatsache ADHS» nicht rein medizinisch in Isolation betrachten lässt, sondern andere Dimensionen bei ihrer Erforschung bewusst mitgedacht werden müssen – schlicht schon deswegen, weil das schon immer schon so geschehen ist, manchmal aber eben nur unbewusst. Das bedeutet auch, sich zu fragen, wann, weshalb und für wen bestimmte menschliche Verhaltensweisen als krank, auffällig oder störend empfunden werden. Und ebenso, wie wir letztlich gesellschaftlich – und nicht nur isoliert wissenschaftlich – damit umgehen wollen.
Das soll aber kein Wasser auf die Mühlen der zahlreichen ADHS-Skeptiker geben, die sich immer wieder in die Diskussion einschalten und von einer «Krankheit» reden, die es eigentlich gar nicht wirklich gäbe. Auch soll das nicht heissen, dass Hirnforschung in Bezug auf ADHS sinnlos oder fehlgeleitet sei.
«Studien, die uns nicht die gewünschten Antworten liefern, offerieren uns trotzdem Wissensbausteine, die in verschiedenen Kontexten Verständnis schaffen können. Sie erweitern dennoch unser Wissen und das Verständnis davon, was ADHS ist», sagt Elena Haegi.
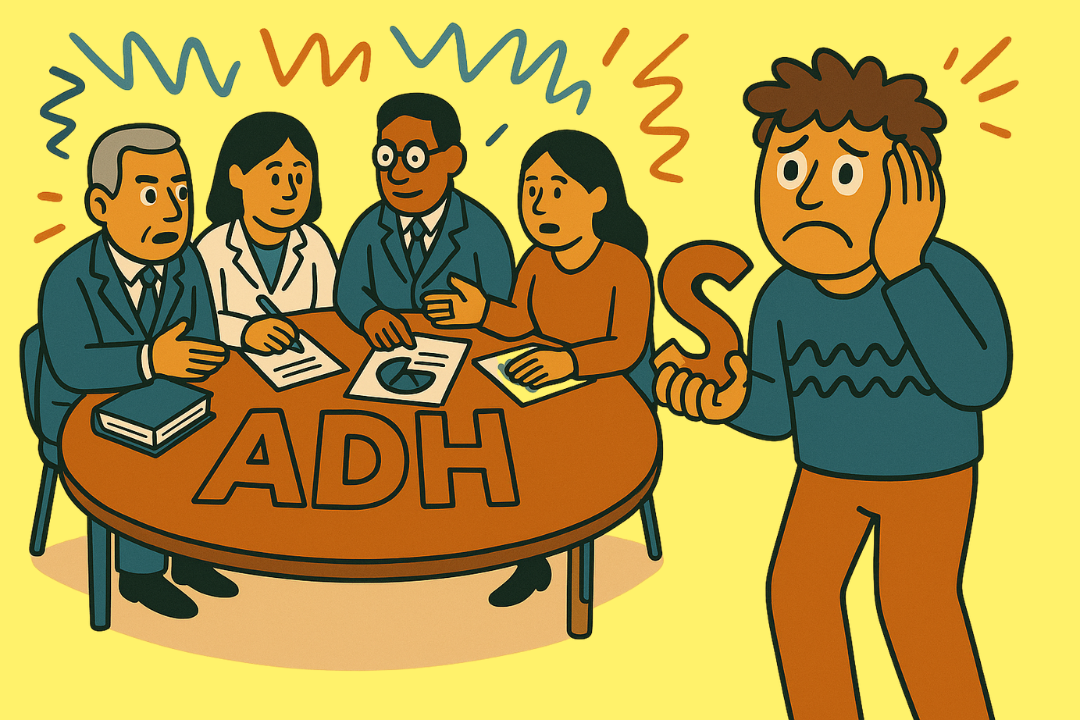
Die Forschung an ADHS muss interdisziplinär – und nicht unter Ausschluss Betroffener stattfinden. (Bild: ChatGPT / rs / Canva)
In den bisherigen Erklärmodellen vermengen sich diverse Dinge: moralische Bewertungen der Betroffenen, Neurowissenschaft, aber sogar Aktivismus – und somit soziale und politische Ebenen.
Und welche Teile einer Diagnose sich rein durch die Entwicklung des Gehirns und dessen Stoffwechsel und Genetik erklären lassen und bei welchen Teilen Umweltfaktoren oder soziale Gegebenheiten mit in die Beurteilung fliessen, wird in der ADHS-Forschung höchst kontrovers diskutiert.
Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass die ADHS-Forschung interdisziplinär geschieht. So beteiligen sich daran Forschende aus Forschungsgebieten, die zum Teil verschiedener kaum sein können: Von der Medizin, Neurologie über Pädagogik bis hin zur Soziologie und sogar der Wissenschaftsphilosophie – die Blickwinkel auf das Thema ADHS sind mannigfaltig. Kein Wunder, dass zwischen den verschiedenen Forschungszweigen aber immer wieder Grabenkämpfe darüber herrschen, wer nun die Deutungshoheit über die Frage haben soll, was ADHS – und wer nun tatsächlich betroffen ist und wer nicht.
Welche Forschung wird gefördert – und welche nicht?
Medizinische, biochemische, psychiatrische und neurologische Ansätze zur Betrachtung von ADHS haben eine gewisse Vormachtstellung inne, da sie als besonders objektiv gelten. Und dies, obschon ihre Sichtweise nicht nur das Ergebnis historischer, sozialer und politischer Prozesse ist, sondern genau diese Prozesse auch massgeblich darüber entscheiden, welche Fachrichtungen überhaupt gefördert werden und in der öffentlichen Debatte Gehör finden.
Das bringt seine eigenen Probleme mit sich: Gebiete, die sich nicht naturwissenschaftlich, sondern auf sozialer oder pädagogischer Ebene mit ADHS befassen, treten oft in den Hintergrund. «Man darf nicht vergessen, dass Studien finanziert werden müssen», gibt Haegi zu bedenken.
«Studien, die als Investitionen angesehen werden, werden also im Forschungskreis bevorzugt, während Studien, die sich ‹nur› auf die Verbesserung der Lebensqualität von ADHS konzentrieren, oder Studien, die ‹bloss› subjektive Daten verwenden, eher vernachlässigt werden.»
Deshalb würden gewisse Stimmen in der öffentlichen Debatte häufiger gehört und akademisch auch eher gefördert, während kleinere Forschungsprojekte oft untergingen, sagt Haegi.
«Hier stellt sich die provokative Frage: Wem sollen ADHS-Studien zugutekommen? Welche Fragen wollen von der Wissenschaft beantwortet werden und welche Fragen werden tatsächlich von Betroffenen gestellt?»
Tatsächlich bringt diese Frage weitere Fragen mit sich: Während Neurologie einen wichtigen Platz in der ADHS-Forschung hat – wie wichtig soll sie eigentlich für den öffentlichen Diskurs sein? Denn: Spielt es für Betroffene, ihr Umfeld, den Arbeitsplatz – also im Alltag – tatsächlich eine Rolle, was da Neuronen und Botenstoffe im Gehirn genau tun? Ändert das etwas an der konkreten Lebensrealität oder den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen?
«Wem sollen ADHS-Studien zugutekommen? Welche Fragen wollen von der Wissenschaft beantwortet werden und welche Fragen werden tatsächlich von Betroffenen gestellt?»
– Elena Maja Haegi, Psycholinguistin
Es ist also darum nicht weiter überraschend: Das Ungleichgewicht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit ADHS führt mithin dazu, dass Betroffene selbst seltener gehört werden.
Sogar in der akademischen Auseinandersetzung: Ein Grossteil der Forschung beschäftigt sich kaum mit der tatsächlichen Lebensrealität von Menschen mit ADHS – und sie stammt dabei meist von Menschen ohne Diagnose. Kein Wunder: Statistisch gesehen haben Menschen mit ADHS schlechteren Zugang zu Bildung, welche aber Voraussetzung dafür wäre, am Forschungsprozess überhaupt teilnehmen zu können.
Nicht zuletzt führen die Grabenkämpfe und das Ungleichgewicht in der ADHS-Forschung auch zu schwierigen Debatten: Wer hat denn nun wirklich ADHS? Und wer nicht? Wird falsch diagnostiziert? Oder überdiagnostiziert? Diesen Debatten widmen wir uns aber in einem späteren Kapitel.
Im nächsten Kapitel geht es weiter um das Hirn – aber eher um die Frage, was es für die Politik und die Gesellschaft bedeutet, wenn wir ADHS als rein individuelle Angelegenheit auf Basis unterschiedlicher Hirne betrachten.
Weiter zu Kapitel 3: Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert
Die ADHS-Sommerserie erscheint in wöchentlich ein bis zwei Kapiteln. Wir informieren Sie jeweils über unseren Spezial-Newsletter, sobald neue Teile erscheinen.
Bereits jetzt haben uns einige Nachrichten – und sogar ein Telefon – erreicht. Darunter: Dank, Fragen, eigene Erlebnisse. Ich möchte diese Nachrichten gerne in eines der späteren Kapitel einfliessen lassen. Haben Sie Fragen, Input – oder möchten Ihre eigenen Erfahrungen zu ADHS mit mir teilen? Schreiben Sie an robin.schwarz@hrtoday.ch