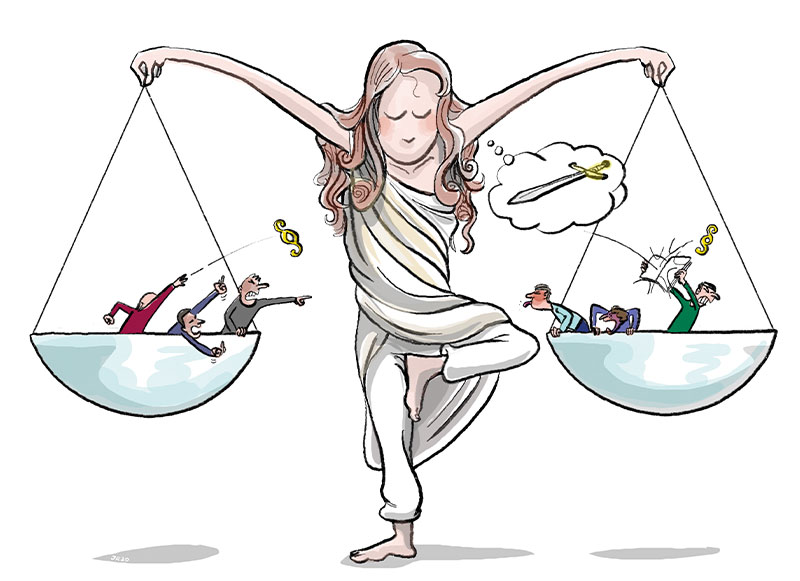Kündigung bei Verdacht: Das gilt für interne Untersuchungen
Ein Bankangestellter wird wegen mutmasslicher sexueller Belästigung entlassen und zieht gegen seine Arbeitgeberin vor Gericht. Das Urteil des Bundesgerichts vom 19. Januar 2024, BGE 4A_368/2023, wirft ein neues Licht auf die Bedeutung und die Grenzen interner Untersuchungen in der Schweizer Arbeitswelt.

Auch bei sexueller Belästigung: Strafprozessuale Garantien gelten nicht bei internen Untersuchungen, zeigt ein Bundesgerichtsentscheid. (Bild: iStock)
BGE 4A_368/2023, Urteil vom 19. Januar 2024
Das Urteil
Gegen den in einer Führungsposition tätigen Bankangestellten B. wurde intern eine Meldung wegen sexueller Belästigung erstattet. Die Arbeitgeberin führte eine interne Untersuchung durch und kündigte nach deren Abschluss den Arbeitsvertrag von B. ordentlich. Daraufhin klagte B. auf Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung.
Das Obergericht des Kantons Zürich hiess die Klage gut und befand, dass die Rechte des Arbeitnehmers bei einer internen Untersuchung «durchaus ähnlich wie in einem Strafverfahren» zu wahren seien. Es beanstandete, dass die Arbeitgeberin bei der Anhörung von B. dessen Recht auf Begleitung durch eine Vertrauensperson verletzt habe. Zudem habe B. keine Gelegenheit erhalten, sich auf die Anhörung vorzubereiten und nach entlastenden Tatsachen zu forschen. Ferner habe sich B. während des Gesprächs nicht wirksam verteidigen können, da er nicht erfahren habe, wann er wen, wo und wie sexuell belästigt habe.
Das Bundesgericht hielt auf Beschwerde der Arbeitgeberin hin fest, dass die strafprozessualen Garantien keine direkte Wirkung auf interne Untersuchungen von privaten Arbeitgebern hätten. Die Arbeitgeberin habe im vorliegenden Fall umfangreiche Abklärungen durch ein eigens dafür vorgesehenes Team getätigt. Dass B. erst zu Beginn seiner Anhörung über deren Zweck und Inhalt informiert wurde, sei nicht zu beanstanden. Auch das Fehlen einer Vertrauensperson bei der Anhörung begründe keine missbräuchliche Kündigung. Dies obwohl B. gemäss einem internen Merkblatt das Recht gehabt hätte, sich von einer solchen vertreten zu lassen. Die Vorwürfe der Arbeitgeberin seien zudem hinreichend präzis dargelegt worden. Es bestehe insoweit ein Zielkonflikt zwischen dem legitimen Selbstverteidigungsrecht des Beschuldigten und dem Schutz der meldenden Person. Dass deren Personalien nicht an diesen weitergeleitet werden dürften, sei unbestritten.
Die Arbeitgeberin sei aufgrund ihrer Abklärungen zum Schluss gelangt, dass sich der Verdacht auf sexuelle Belästigung gegen B. erhärtet habe. Die Arbeitgeberin habe die Kündigung daher nicht leichtfertig oder ohne vernünftige Gründe ausgesprochen. Verdachtskündigungen seien zulässig und nicht einmal dann missbräuchlich, wenn sich der Verdacht später als unbegründet erweise. Die Arbeitgeberin müsse somit nicht beweisen, dass die Vorwürfe zutreffen würden. Die Vorinstanz habe die interne Untersuchung mit einem überzogenen Massstab beurteilt und von der Arbeitgeberin teilweise mehr verlangt als von einer Strafverfolgungsbehörde gefordert werden dürfte. Die Vorinstanz habe die Kündigung daher zu Unrecht als missbräuchlich qualifiziert.
Konsequenz für die Praxis
Das vorliegende Urteil relativiert die Anforderungen, die an eine interne Untersuchung von privaten Arbeitgebern gestellt werden dürfen, deutlich. Seit einem Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2016 (4A_694/2015) bestand diesbezüglich einige Unsicherheit. Das Bundesgericht betont zu Recht, dass ein Arbeitsverhältnis – im Gegensatz zu einem Strafverfahren – auf freiwilliger Basis beruht und dass die Anwendung strafprozessualer Regeln auf interne Untersuchungen daher ausgeschlossen ist. Die Arbeitgeber müssen Vorwürfe und Anschuldigungen gegenüber Mitarbeitenden zwar nach wie vor genügend abklären, bevor sie eine Kündigung aussprechen. Die Anforderungen an die Rechte, die dem beschuldigten Arbeitnehmenden zu gewähren sind, dürfen dabei jedoch nicht überspannt werden.